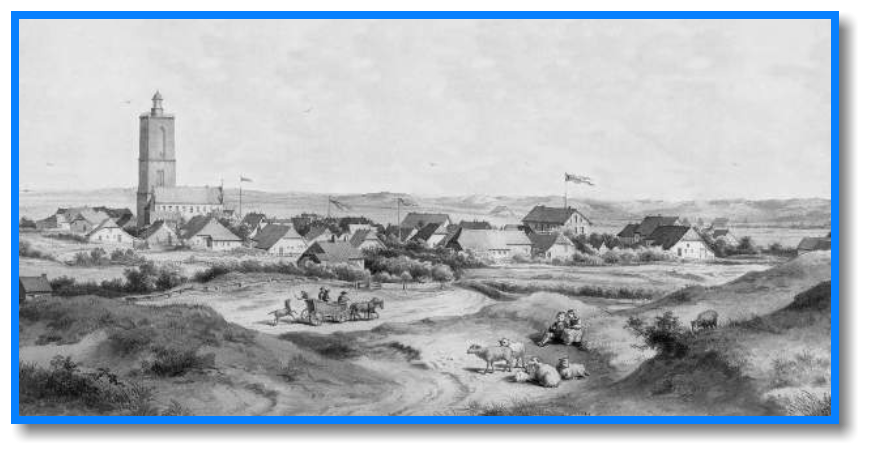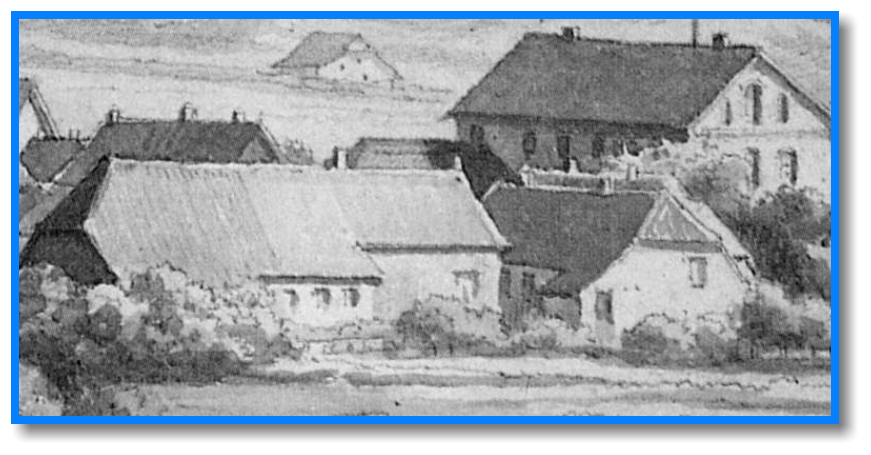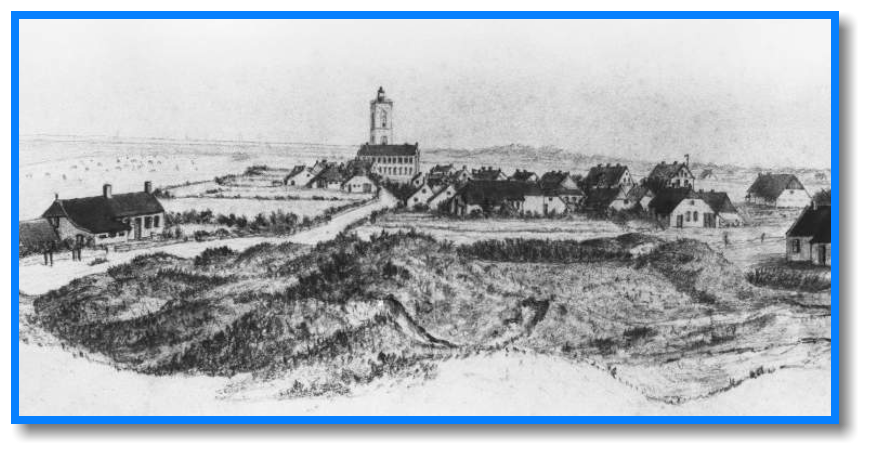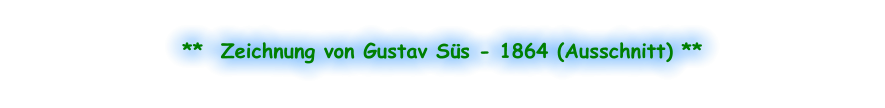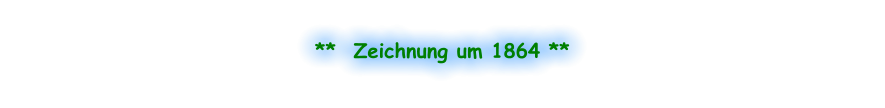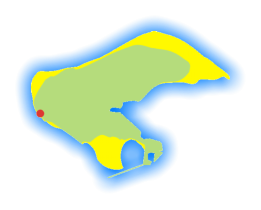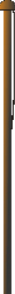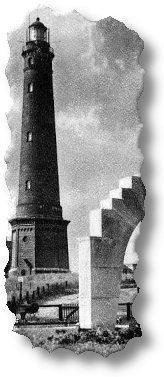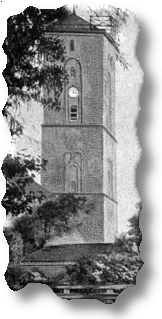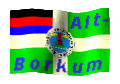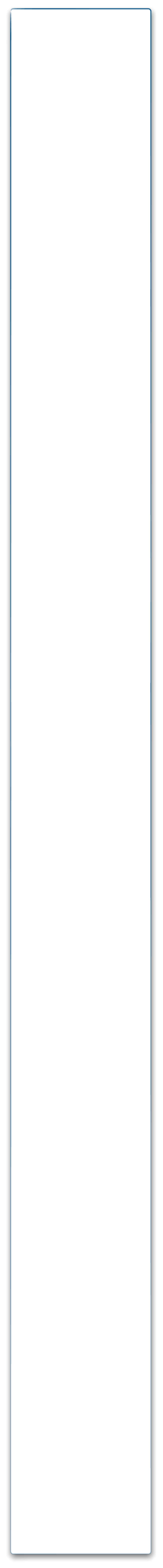
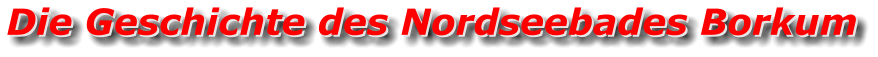

Schon von 1800 an, zu dieser Zeit begann man mit der Einrichtung der ersten
Seebäder an der Nordsee, wurde Borkum als Seebadeort - allerdings fast
ausschließlich nur von Emder Familien - zum alljährlichen Sommeraufenthalt
aufgesucht. Gasthöfe und Pensionen im eigentlichen Sinne gab es zu der Zeit noch
nicht. Die Insulaner selbst kümmerten sich kaum um die Fremden.
Die wenigen Häuser, die sich den Gästen öffneten, dienten nur als notdürftige
Unterkunft. So waren die Urlauber gezwungen, neben Lebensmittel und Geschirr
beispielsweise auch ihre eigenen Betten mitzubringen. Selbst für ihre Badezelte
mussten sie selber sorgen. Die Ansprüche, die man an die Ortsverwaltung stellen
konnte, waren ebenfalls sehr gering. Dennoch lag die Gästezahl um 1840 bereits bei
60 bis 80 Personen.
Der obige Bildausschnitt zeigt in der linken oberen Bildecke den Uhlenkampschen
Gasthof, das spätere Dorfhotel.
Bei dem größeren Gebäude im obigen Bildausschnitt handelt es sich um das spätere
Hotel Bakker. Auf der auf dem Dach des Hauses gehissten Fahne ist der Schriftzug
Bakker zu sehen.
Abschrift
ZUR GESCHICHTE DES BADES.
Mit dem Jahre 1850 beginnt die eigentliche Geschichte der Insel Borkum als Kur-
und Badeort. Schon lange vor diesem Jahre wurde allerdings Borkum insbesondere
von Emder Familien zum alljährlichen Sommeraufenthalt aufgesucht. Um die Zeit
etwa, als man überhaupt an der Nordsee, von 1800 an, mit der Einrichtung von
Seebädern begann, wird auch schon Borkum als Seebadeorf, wenn auch nur in
beschränktem Maße, bekannt. Die Ansprüche, die man an die Ortsverwaltung stellte,
waren naturgemäß sehr gering, ja fast Null; man brachte Betten, Lebensmittel,
Geschirr mit und sorgte selbst für Badezelte. Gerade in dieser Selbstherrlichkeit wird
ein Hauptanreiz des Sommeraufenthalts gelegen haben. Die paar Häuser der
Insulaner, die sich für wenige Taler den Fremden öffneten, dienten nur als
notdürftige Unterkunft; Gasthöfe gab es nicht. Um 1840 kamen schon 60 bis 80
Gäste, aber die Insulaner kümmerten sich kaum um die fremden Familien; der
Mehrzahl wäre es vielleicht am liebsten gewesen, wenn auch diese paar Fremden
von der Insel weg geblieben wären. Aber der Ruf des Bades als Heilanstalt begann
sich zu begründen. Das geht hervor aus der ersten öffentlichen Ankündigung über
das Bad in einem Bericht des Chirurgus Ripking, veröffentlicht in der Ostfriesischen
Zeitung vom 10. Mai 1846. Danach hat sich dieser Chirurgus entschlossen, in der
Badesaison kränkliche Knaben von 6-12 Jahren und allenfalls noch ältere, an
Skrofeln (Anmerkung: Scrofular: Halsdrüsengeschwulst, vorzugsweise bei Kindern, vermutliche
Ursache eine Allergie und nicht wie früher angenommen Tuberkulose) und ähnlichen Uebeln
Leidende in seiner Wohnung aufzunehmen. Ripking verpflichtet sich, die Kinder in
den Wissenschaften zu fördern und in hygienischer Beziehung zu überwachen ― und
zwar für den Spottpreis von 3 Talern, obwohl er von den teuren Lebensmitteln redet.
Im Jahre 1849 übernahm Landchirurgus Rhode seine Stelle, und was sein Vorgänger
begonnen, das hat er tatkräftig fortgeführt. Mit dem Sommer 1850 beginnt seine
eigentliche Tätigkeit für das Bad ; von da an erscheinen auch Badelisten, und die
Gemeindeverwaltung sorgt für Badeeinrichtungen. In der Ostfriesischen Zeitung
vom 16, Juli 1850 veröffentlicht Rohde eine Beschreibung der Insel und Klarlegung
der das Seebad betreffenden Verhältnisse. An den 80 Ortshäusern, in holländischem
Stil erbaut, chaotisch durcheinander, aber malerisch geordnet, rühmt er
zweckmäßige Einrichtung, an den Insulanern wirklich außerordentliche
Freundlichkeit und Biederkeit. Imponierend erscheint ihm das zur Zeit der
französischen Okkupation entstandene und von den Franzosen hinterlassene
Souvenir, eine große bis dato sehr gut erhaltene Schanze (die auch heute noch
kenntliche Franzosenschanze auf der Binnenwiese). Badelustige Fremde werden
über Greetsiel und Emden mit Segelschiffen befördert, seit 1847 vermittelt auch der
Dampfer „Kronprinzessin Marie" die Beförderung, doch nur an einzelnen Tagen des
Sommers. Die Insulaner sind stets bereitwillig, Fremde aufzunehmen; jedes Haus
kann mindestens zwei Piecen abstehen. Für Kost sorgen die Badegäste
durchschnittlich selbst, doch findet man dieselbe auch in Wirtschaften. Betten
werden mitgebracht. Die Badeeinrichtungen befinden sich am Weststrande und zwar
solche für männliche und weibliche Individuen; nötige Sicherheitsmaßregeln sind
getroffen Das Aus- und Ankleiden geschieht in kleinen, von den Badenden selbst zu
errichtenden leinenen Zelten, oder in sehr billig zu mietenden hölzernen.
Im Bericht des nächsten Jahres gibt Rhode eine Ergänzung zu diesen Ausführungen.
Der Sommer 1850 war danach für das Bad wegen der beständig rauhen, naßkalten
Witterung sehr ungünstig; immerhin belief sich die Zahl auf etwa 250, ein für das
erst im Entstehen begriffene Badeinstitut sehr befriedigendes Resultat. Rohde rühmt
besonders den regelmäßigen, starken Wellenschlag, die in allen Dingen und
Verhältnissen sich kundgebende Simplizität, die wohltuende Ruhe im Gegensatz zu
den politischen Unruhen der letzten Jahre (1848!). Borkum nennt er ein wahrhaft
neutrales Ruheplätzchen; hier verschmelzen alle politischen Parteien zu einer
einzigen Koalition, welche einstimmig die souveräne Regierung des großen Neptun
anerkennt.
In den ersten Jahren seines Bestehens wurde das Bad gewöhnlich am längsten Tage
(21. Juni) eröffnet. Von den Aufwendungen und Verbesserungen aus dieser Zeit
erfahren wir folgendes: Statt der 14tägigen Verbindung mit dem Festlande wird eine
8tägige, abwechselnd nach Emden und Greetsiel eingerichtet. Vom Ort (der damals
allein noch um den alten Leuchtturm sich gruppierte) wird ein Weg aus Soden
(Rasenstücken) nach dem Weststrand gelegt (das ist der Fußpfad, der später zur
Strandstraße ausgebaut wurde). Zur Unterhaltung dieses Weges und zur Bewachung
der zum Aus- und Ankleiden errichteten Zelte wurde ein Aufseher angestellt. Das
Bad selbst blieb kostenfrei. Badelisten wurden genau aufgestellt und durch die
Ostfriesische Zeitung veröffentlicht. Im Jahre 1852 wird mit Unterstützung der
Ostfriesischen Landschaft, die eine Beihilfe von 50 Talern gewährte, ein Badezelt am
Herrenstrand erbaut. Gastwirt van Dyk legte eine Kegelbahn an und sein Kollege
Visser errichtete ein großes Sommerzelt „diensam zu Konversationen, Zweckessen,
Tanzpartien“, welches er bald darauf um die Hälfte vergrößerte. Auch Dr. Rohde
vergrößerte sein Pensionat; 1854 zeichnet er zum ersten Male als Vertreter der
Badekommission. So entwickelten sich ganz langsam und stetig aus den
Bedürfnissen heraus die Veranstaltungen der Gemeinde und der Insulaner für den
sommerlichen Badeverkehr.
Das Jahr 1856 brachte eine bedeutende Verbesserung der Reiseverhältnisse und im
Zusammenhang damit einen neuen Aufschwung des Bades. Am 23. Juni gen. Jahres
wurde die Hannoversche Westbahn von Rheine nach Emden eröffnet, die Anschluß
sowohl von Hannover über Osnabrück, wie auch aus Westfalen und Rheinland hatte,
und wie Emden damit aus seiner isolierten Lage heraustrat, so war auch den an der
See Heilung Suchenden eine bequeme Reisegelegenheit geschaffen. Das
Badepublikum wurde mit der Eröffnung der Westbahn ein anderes; es kamen mehr
und mehr auch Nicht-Ostfriesen. „Dütsen", wie sie der Borkumer nannte. Die alte
Einfachheit schwand; eine „gewisse Dissension in Bezug auf gesellschaftlichen
Verkehr", wie es in den Zeitungsberichten heißt, schien obzuwalten; die
„platzgreifende Etikette bietet den älteren Stammgästen nur gène". Der Inselort
faßte damals 200 Fremde, darüber hinaus gab es Ueberfüllung (heute finden über
8000 Badegäste auf einmal bequemes Unterkommen!) Am 15. Juli 1856 sind 160
Gäste und 40 Passanten verzeichnet; die Gesamtzahl der Gäste stieg während des
Sommers auf 600. Im ganzen wurden 1856 vierzig Schiffsreisen gemacht, 15 durch
die beiden ostfriesischen Dampfschiffe und 25 durch 3 Segelschiffe (im Sommer
1909 wie im Vergleich hierzu erwähnt sei, allein von Emden aus annähernd 400
Dampferfahrten! Dazu kommen dann noch die Verbindungen mit Hamburg-
Helgoland, Bremerhaven, den Nachbarinseln und mit Holland.) Rohde bedauert, daß
im September die regelmäßigen Fahrten aufhören; es muß also auch damals schon
die Neigung bestanden haben, die Kurzeit bis in den Herbst hinein auszudehnen, die
im weiteren Verlauf dann schließlich zur Winterkur führte. Etwa 500 Personen
nahmen 1856 nach Schätzung 12000 Bäder in offener See; der Wellenschlag war am
besten am Damenstrand infolge augenblicklicher Formation des Strandes.
Das Jahr 1857 brachte den Besuch des Königs Georg V. Das Dorf war zum Empfange
festlich geschmückt! Eigenartig war eine Ehrenpforte aus Walfischknochen, die
bekanntlich aus den blühenden Zeiten der Borkumer Walfangfahrten stammen und
auch heute noch als Einfriedigungen von Gärten erhalten sind. Rhode beklagt in
seinem Jahresbericht für 1857, daß immer noch nicht die Kalamität in der
Verproviantierung der Gäste behoben sei. Gäste, die ohne Kochtopf und Löffel hier
ankommen, sind übel daran. Diejenigen die im Visserschen Zelt einen Tischplatz
ergattert haben, klagen über Tischraum und tropische Hitze. Seit 1858 werden
Badelisten, die bis dahin nur aus privaten Zusammenstellungen bestanden, offiziell
geführt und durch die Ostfriesische Zeitung veröffentlicht.
Im Jahre 1860 übernahm Gastwirt Köhler aus Hannover, der jahrelang „auf
Norderney servierte," den Uhlenkampschen Gasthof (hernach Köhlers Dorfhotel) und
richtete regelmäßige table d'hôte ein. Einige Jahre später wurde von ihm auch die
„Giftbude" am Strande erbaut, eine jener für den Strand der deutschen
Nordseebäder typischen Erholungsstätten, die nach dem Bad auch den inneren
Menschen die sattsam bekannten „giftigen Reizmittel" bieten. Aus dieser Giftbude
ist allmählich das jetzt so imposante Strandhotel entstanden, das übrigens bei
aufmerksamer Betrachtung in seinem Aeußern sein allmähliches Wachstum und drei
Perioden seiner Baugeschichte erkennen läßt ― ein monumentales Dokument auch
für die Entwickelungsgeschichte des Bades selbst.
Gleich nach 1860 entstanden transportable Badekutschen für Herren und Damen.
Man stellte einen Badewärter an, und die Badezeit wurde durch Aufhissen einer
Flagge angezeigt. Im Dorf und im Köhlerschen Gasthof waren Fluttabellen
ausgehängt. So wuchs das Bad allmählich in seine Aufgaben hinein. Ein besonderes
Verdienst um die zweckmäßige Ausgestaltung der öffentlichen Einrichtungen
gebührt unbedingt dem allezeit rührigen, schriftstellernden Arzte Dr. Rhode; seiner
gelegentlichen Bemerkung, daß er der Veranstalter aller seit zwölf Jahren
bestehenden Badeeinrichtungen sei, kann kaum widersprochen werden.
Was im weiteren Verlauf der Jahre geschaffen wurde, gehört noch nicht der
Geschichte an, sondern spielt schon in die Gegenwart hinein. All die neueren
Einrichtungen, die getroffen wurden, um den höheren Ansprüchen zu genügen, die in
der neueren Zeit naturgemäß an Hygiene und Badetechnik gestellt werden, zeugen
von dem Ernst und Eifer, mit dem die von der Gemeinde, aus der Reihe ihrer
Mitbürger gewählte Badekommission sich ihrer nicht immer, “dankbaren“ Aufgabe
widmete. Auf Schritt und Tritt begegnet man so vielerlei Dingen, seien es
Einrichtungen äußerer Art oder innere Verwaltungsvorschriften, die alle mit Umsicht
und Beharrlichkeit haben bedacht und ausgeführt werden müssen und nun in ihrer
Gesamtheit dem Bad den Charakter eines durchaus modern verwalteten Kur- und
Badeorts geben. Wenn so auch die „Steine reden", so dürften noch einige
Streiflichter auf die weitere Entwickelung des Bades von Interesse sein.
Was zunächst die äussere Gestaltung der Insel anbetrifft, die wie ihre Nachbarn dem
zerstörenden Einfluß von Flut und Wellen in bedrohlichem Maße ausgesetzt ist, so
haben die von der Regierung ausgeführten Buhnenbauten und die
Strandschutzmauer ihren Zweck zum Teil erfüllt. Wären sie nicht gewesen, der
Dünenwall wäre schon lange abgenagt und das Meer hätte Zutritt zur Binnenwiese
gefunden, ein Ereignis, das sich beispielsweise auf dem benachbarten holländischen
Eiland Rottum schon vollzogen hat und dort den dauernden Bestand der Insel
ernstlich in Frage stellt. Mit dem Buhnenbau, der die Erhaltung des Strandes gegen
die abspülende Wirkung von Flut- und Ebbeströmungen zum Zweck hat, wurde 1869
begonnen. Zum Schütze der Dünen wurde im Jahre 1874 an der gefährlichsten Stelle
zunächst ein Pfahlwerk von 500 m Länge errichtet, später ging man zum Bau der
Strandmauer über. Ende der sechziger Jahre begann man, auch Ost- und Westland
von Borkum wieder miteinander zu verbinden, Jahrzehntelang war zwischen beiden
eine durch den Einbruch des Meeres verursachte, fast eine halbe Stunde Weges
breite, bei hoher Flut überschwemmte Niederung. Durch eingegrabene Strohbündel
und durch Helmanpflanzungen beförderte man mit Erfolg die Neubildung von Dünen,
und der heutige Dünendamm, das „Tüskendöör," sichert nach menschlichem
Ermessen auf die Dauer die Verbindung.
Um die Heilmittel der Insel auch für schwächlichere Naturen mehr auszunutzen, zog
schon 1853 Dr. Rhode in Erwägung, Einrichtungen zu treffen, um auch warme
Seebäder verabreichen zu können. Aber erst 1875 kam es zum Bau der ersten
Warm-badeanstalt, die 1894 ganz bedeutend erweitert wurde und danach von Jahr
zu Jahr in der inneren Einrichtung immer mehr Verbesserungen erfuhr, besonders
auch, als für die Lesehalle, die anfänglich in der Warmbadeanstalt untergebracht
war, 1901 ein besonderes Gebäude aufgeführt wurde.
Ein völliger Umschwung in den Landungsverhältnissen auf der Insel vollzog sich mit
dem Bau der festen Landungsbrücke an der Fischerbalge und der Inselbahn von dort
ins Dorf, die 1888 in Betrieb genommen wurden. Bis dahin war die Landung recht
unbequem. Man mußte vom Dampfschiff zunächst ins Boot steigen ― und bei
unruhigem Wetter war das häufig eine recht üble Sache ― und vom Boot aus wurde
dann der im Wasser die Gäste erwartende hochrädrige Wagen bestiegen, der auf
endlos langem Weg vom Südoststrand seine Insassen ins Dorf brachte. Gelegentlich
nur ― bei stillem Wetter ― konnte am Südstrand gelandet werden, wodurch die
Fahrt ins Dorf wesentlich abgekürzt wurde, und es wurde schon als ein großer
Fortschritt begrüßt, als von dem Emder Senator Dantziger hier eine hölzerne
bewegliche Landungsbrücke gebaut wurde. Man kann sich heute kaum einen Begriff
von den damaligen Kalamitäten machen, und man darf gerade den Bau der
Inselbahn als eine der bedeutendsten Verkehrsverbesserungen bezeichnen. Ohne
die feste Landungsbrücke und die bequeme Bahnfahrt wäre an eine Bewältigung des
heutigen Verkehrs gar nicht zu denken. Im Zusammenhang mit dem
Stationsgebäude der Bahn wurde 1888 auch das Postamt eröffnet. Ein ständiges
Postamt war 1885 errichtet worden. 1863 wurde die erste Telegraphenverbindung
mit dem Festland hergestellt.
Was die hygienischen Einrichtungen des Badeortes anbetrifft, so wurde zuerst im
Jahre 1891 die Kanalisation angelegt, dann folgte 1895 das Schlachthaus, 1900 die
Wasserleitung und in demselben Jahre auch die Gasanstalt.
Die Sorge für die kirchlichen Bedürfnisse hat sich nicht nur nach den Sommergästen
gerichtet, sondern mußte auch der größeren Seelenzahl der ständigen Bevölkerung
gerecht werden. Die alte Ortskirche, die am Fuß des „alten Leuchtturms" lag, wurde
mit der Einweihung der neuen Evangelisch-reformierten Kirche im Jahre 1896
entbehrlich. Katholischer Gottesdienst wurde auf der Insel schon 1865 eingerichtet
und die Katholische Kirche „Stella maris" wurde 1881 eingeweiht. Die Lutherische
Kirche wurde 1897 erbaut.
Zur Umgestaltung des Ortsbildes trug wesentlich auch die Errichtung der
Leuchttürme - 1876 der neue Leuchtturm, 1888 der elektrische Leuchtturm in
Verbindung mit dem Ems-Leitfeuer - mit bei; dadurch ist Borkum die türmereiche
Insel geworden Das war ein Geschenk, das ihr durch die Lage an der Emsmündung
zufiel. Die Geschichte aber des Dorfes Borkum in den letzten 60 Jahren ist die
Geschichte des Bades. Die gänzlich umgestalteten Erwerbsverhältnisse haben ein
ganz neues Borkum entstehen lassen. Vor 60 Jahren war Borkum das einfache
idyllische Inseldorf mit 80 Häusern, heute ist es ein stattlicher Ort mit vielen Hotels,
eleganten Villen, zahlreichen öffen-lichen Gebäuden, Inselbahn, Post, Telegraph,
Telephon (mit Anschluß an das Telephonnetz des Festlandes und Gesprächsverkehr
nach den Hauptplätzen), Gas- und elektrischer Beleuchtung, Wasserleitung,
Kanalisation, kurz ein Badeort größten Stils, der nach allgemeinem Urteile den
Einfluß einer sorgsamen und soliden Verwaltung erkennen läßt. Eine nach festem
Plane geregelte Bautätigkeit hat es mit sich gebracht, daß der Ort durchaus keinen
unfertigen, sondern einen gepflegten netten Eindruck macht. Im Laufe der letzten
Jahre haben alle Straßen, sowohl in den älteren, wie auch in den neu angebauten
Teilen Pflasterung erhalten. Die Straßen-Abfallstoffe werden jeden Morgen in der
Frühe abgekehrt und nach dem weit entlegenen Unratplatze gefahren, wo sie durch
Vergraben beseitigt werden. Inzwischen ist das Straßennetz, auch außerhalb des
Ortes, noch weiter ausgebaut. Nach dem Strande führen beispielsweise fünf breite
und bequeme Straßen; die Bismarck-, Prinz Heinrich-, Strand-, Viktoria- und von
Frese-Straße. Der hohe Dünenrand am Strande, der von Hotels und Logierhäusern
wie von stolzen Palästen gekrönt wird, ist zur prachtvollen Kaiserstrasse ausgebaut,
die in Verbindung mit den Hotel-Veranden eine großartige Meeres-Terrasse bildet ―
eine Anlage, wie sie in dieser Ausdehnung und günstigen Lage kein anderes
Nordseebad aufzuweisen hat. Einen monumental wirkenden Abschluß nach dem
tiefer liegenden Strande hin hat diese hochgelegene Terrasse nunmehr durch die
Wandelhalle bekommen, die in ihrem wesentlichsten, dem mittleren Teile, schon für
die Kurzeit 1911 fertiggestellt war. Diese ganze neue Anlage umfaßt eine bequeme,
geräumige Promenade mit Musikpavillon in unmittelbarer Nähe des Strandes und in
Höhe der Strandmauer, die gleichzeitig umfangreich genug ist, um einen
ungestörten Verkehr während des Strandkonzerts zu ermöglichen, und außerdem
einen überdachten Raum, die eigentliche Wandelhalle, die auch bei weniger
freundlichem Wetter einen geschützten Aufenthalt bietet. Das gewaltige Bauwerk ist
dem früher offen liegenden Dünenabhang unmittelbar vorgebaut und schließt nach
dem Strande hin mit der alten Strandmauer ab. Der Gesamtkostenaufwand beträgt
eine halbe Million Mark. Die neue Promenade mit Wandelhalle liegt etwas tiefer als
die Kaiserstraße, die bis dahin schon, wie oben erwähnt, eine unvergleichliche
Meeresstraße bildete und nunmehr durch die architektonische wirksame
Zinnenkrönung des Daches der Wandelhalle eine Verbindung mit der neuen Anlage
erhalten hat, durch die ihr eigener bisheriger Charakter nur noch gehoben wird. Der
mittlere zunächst hergestellte Teil von 170 Meter Länge hat zwei seitliche, mächtige
Treppenanlagen, die von der Kaiserstraße zum Strande hinunterführen. Dazwischen
ist die 8 Meter tiefe Wandelhalle eingebaut und davor liegt der 3000 Quadratmeter
große Konzertplatz mit in der Mitte vorgelagertem Musikpavillon. In der Wandelhalle
sind auf das modernste ausgestattete Garderoben- und Toilettenräume eingerichtet.
Ein 250 Quadratmeter großer Mittelraum der Wandelhalle mit Büffetteinrichtung
ermöglicht Einnahme von Erfrischungen auch am Strande. Ohne Ueberhebung darf
von der neuerbauten Wandelhalle behauptet werden, daß kein deutsches Seebad
etwas auch nur annähernd dem zu vergleichendes an die Seite zu stellen hat. Die
Wandelhalle hat diese Strandpartie noch mehr, als es bisher der Fall war, zum
Mittelpunkt des Badeverkehrs gemacht.
Eine, wenn auch unwesentliche Aenderung in dem Gesamtbild des Bades trat durch
die Errichtung von Befestigungsanlagen ein; Borkum rückte damit in die Reihe der
Seefestungen. Auf den Charakter und die Entwickelung des Bades hatte dies jedoch
keinerlei Einfluß, Stieg doch die Besucherzahl, die 1906 21611 betrug im Jahre 1913
auf 30000.
Das Jahr 1914 hätte Borkum den Höchstpunkt in der bis dahin erreichten
Besucherzahl mit über 35 000 gebracht, wäre nicht dieser unselige Krieg
ausgebrochen.
Fluchtartig waren die Gäste gezwungen die Insel zu verlassen. Die Saison war
unterbrochen. Unermeßlichen Schaden erlitten die Bewohner während der
Kriegsjahre. Jeglicher Badeverkehr war gesperrt; die einzige Erwerbsquelle, das
Bad, war versiegt.
Das Jahr 1919 brachte nach 5 Kriegsjahren die erste Saison. Nach Möglichkeit wurde
versucht aus den von den Requisitionen der Heeresstellen noch übrig gebliebenen
Resten die Badeeinrichtungen wieder aufzubauen. Erfreulicherweise brachte uns das
Jahr 1919 13129 Gäste
Das Jahr 1920 zeigte einen Aufstieg. 20000 Gäste weilten in diesem Jahre zur
Erholung auf unserer grünen Insel.
Wenn auch die Einrichtungen des Bades auf eine weit größere Zahl Besucher
eingestellt sind, so ist doch wieder ein Anfang gemacht, der der Badeverwaltung und
den Einwohnern den Mut gibt, rastlos auf Verbesserung der gesamten
Badeeinrichtungen bedacht zu sein.
So wurde am Ausgang der v. Fresestrasse, gleich wie am Ausgang der
Bismarckstraße, eine bequeme Rampe errichtet. Die Bootsbrücke wurde wieder
hergestellt. Es erfolgte die Errichtung weiterer Badezelte, sodaß diese Einrichtungen
selbst dem stärksten Andrang genügen. Die Toiletten am Strande wurden vermehrt,
das Licht- und Luftbad verbessert. In diesem ist die Einrichtung getroffen, daß
Luftbäder in besonderen Einzelzellen genommen werden können.
Das Warmbad hat ein elektr.-therapeuisches Ambulatorium, ausgestattet mit den
modernsten Apparaten für Höhen-Sonne, elektr. Vibrationsmassage, elektr.
Zellenbäder usw. erhalten.
Durch diese Einrichtung ist den vielseitigen Wünschen unserer Gäste, hauptsächlich
aus Ärztekreisen, Rechnung getragen und somit die Möglichkeit gegeben, die
natürlichen Heilkräfte der Nordsee mit den künstlichen zu verbinden.
Der weit verbreitete bedeutende Ruf unseres Bades der uns alljährlich ausser den
ständigen Kurgästen zahlreiche neue Besucher zuführt, ist für uns ein Sporn
gewesen, alle Neuerungen auf dem Gebiete der Ortshygiene und der Badetechnik in
denkbar vollkommenster Form auszuführen.
Die der allgemeinen Wohlfahrt dienenden sanitären und hygienischen Einrichtungen
des Orts, die im Laufe der Jahre unter großem Kostenaufwande geschaffen sind,
stehen heute auf der Höhe der Zeit und entsprechen den weitgehendsten
Anforderungen; sie bieten alle Gewähr für einen gesunden und bekömmlichen
Aufenthalt.
Die Badedirektion.
Weitere Abschriften:
Borkum, Borchana, kleine Insel auf dem deutschen Meer, nicht weit von der Provinz
Groningen, zu welcher sie auch gehört.
Aus Johann Hübners reales Staats- Zeitungs- und Conversations- Lexicon, Leipzig 1782
______________
Borkum, die westlichste der ostfriesischen Inseln, vor der Mündung der Ems gelegen
und zur preuß. Landdrostei Aurich gehörend, hat einen Umfang von 25 - 30 Kilom.,
einen 65 Meter hohen Leuchtturm und 394 Einw. Ein breites Watt theilt sie in zwei
Theile. B. (das Fabaria des Drusus) ist seit 1856 zum Seebad eingerichtet und zählt
jährlich über 1000 Badegäste. Vgl. Berenberg, Die Nordseeinsel B. (4. Aufl., Emden
1873).
Aus Meyers Konversations = Lexikon, Leipzig 1874
Anmerkungen:
•
Faba = Bohne; Drusus = Beiname eines Zweiges des röm. Geschlechts der Livier.
•
In Verbindung mit “Fabaria des Drusus” wird gleichwertig “Burchana des Plinus” ( Plinus -
ca. 50 nach Christi) genannt. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um die Großinsel
“Bant” handelt, die nach Sturmfluten im Mittelalter ( 1200 - 1400) in die Inseln Borkum,
Bant, Juist und Buise zerrissen worden ist.
•
Der Name Borkum lässt sich vermutlich über die folgende Namenkette herleiten: Burchana
-> Borkna -> Borkyn -> Borkum.
______________
Borkum, ostfriesische Insel, Seebad, 3200 E.
Aus Knaurs Konservationslexikon, Berlin 1932